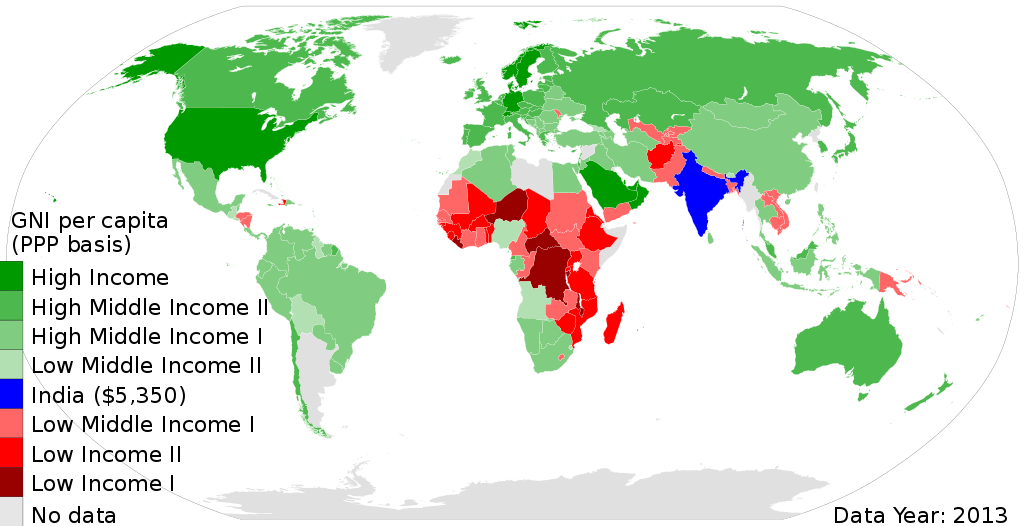Vor dem Wochenende wurden die Ergebnisse der Sondierungen zwischen SPD, Grünen und FDP in einem gemeinsamen Sondierungspapier veröffentlicht. Dieser Ausbund an Transparenz und neuem konstruktivem politischen Ton an sich fand, unter den – grob – Sympathisant*innen der drei Parteien, viel Lob. Ebenso wie die Grundrichtung des Papiers mehrheitlich gut aufgenommen wurde – mit Abstrichen wo offensichtlich ein Kompromiss nötig war (Tempolimit bei den Grünen, Mindestlohn bei der FDP, Steuererhöhungen bei der SPD) und einer latenten Oberflächlichkeit des Ganzen, die m.E. in der Natur der Sache liegt. Sondierung ist ja noch nicht Koalition, die müssen natürlich noch übers Eingemachte reden und gerade geht’s erstmal darum, zu zeigen, dass man konstruktiv zusammenarbeitet. Dennoch gab es im Papier eigentlich schon einige recht konkrete Punkte, die offenbar als rote Linien schon festgezurrt sind. Und eine davon scheint, in meiner – weitgehend links der Mitte angesiedelten – Bubble, erheblich für Unmut zu sorgen, ohne dass ich selbst je auf die Idee gekommen wäre, dass jemand das kritisch sehen könnte, zumal aus dem linken Spektrum. Die teilweise Kapitaldeckung der Rente. Ich lese, dass ausgerechnet das scheinbar die Aushöhlung der Interessen der Arbeitnehmer*innen darstellt. Dass damit auch noch die Rente dem bösen Kapital einverleibt werden soll und vieles derartiges mehr. Und wundere mich etwas. Mir erscheint seit vielen Jahren eine Kapitaldeckungskomponente in der Rentenversicherung unerlässlich. Und Kritik an dieser Ansicht kam bisher da eher von liberaler Seite, nämlich mit dem Argument „ineffizient“, „bindet unnötig Ressourcen“. Aber lehnen wir uns kurz zurück und betrachten die Geschichte der Rentenversicherung in Deutschland, die ja scheinbar in ihrer Umlagefinanzierung, orientiert am Beitragsaufkommen und beziehbar bitteschön möglichst ab 65 schon immer so war… Interessant ist dabei – aber das nur am Rande, dass obwohl wir doch im Mittel wissen, dass unsere Renten umlagefinanziert sind, dennoch der Anspruch auf eine Rente dieser und jener Höhe nach soundsoviel Jahren sich – meiner Wahrnehmung nach – aus einem gedachten „Rentenkonto“ ableitet, das eben doch irgendwie im Kopf da zu sein scheint, auf das man immer eingezahlt hat und das man jetzt Bitteschön auch nach langer Leistung zurückhaben will. Das liegt aber vermutlich auch an der Kommunikation, sowohl durch die Rentenversicherung selbst als auch durch die Politik.
Einschub: Wenn man Vorlesungen hält, neigt man ja dazu, Geschichten zum Stoff zu sammeln, um das zu lernende anschaulicher oder greifbarer zu machen. Die Einordnung des Rentensystems in seine Geschichte ist eine meiner erfolgreicheren Aufweckungsgeschichten für Grundstudiums-Studierende gewesen – die andere befasst sich mit dem völlig überraschenden Umstand, dass unser Geld gar keine Deckung in Gold hat… es ist erstaunlich wie lang sich Dinge nach ihrer Abschaffung in den Köpfen des kollektiven Bewusstseins halten…
Wie die meisten von uns sich vielleicht noch erinnern, geht die deutsche Rentenversicherung auf Bismarck zurück, der korrekt erkannte, dass man was gegen soziale Spaltung tun muss, um Revolution zu verhindern, wenn man erstmal anfängt mit der Industrialisierung und damit eine ganz neue Klasse, nämlich die Arbeiter*innen in seiner Gesellschaft unterzubringen hat. Leute also, die nicht im Rahmen von familiärer und Dorfgemeinschaft im Alter aus der (Subsistenz-)Landwirtschaft versorgt wurden, sondern ansonsten invalide und wenig nützlich den jüngeren Arbeiter*innen auf der Tasche und dem knappen Wohnraum lagen. Auch wurden Menschen halt durch und bei der Arbeit krank und brauchten dann Versorgung, weshalb Rehabilitation ebenfalls mit in der Rentenversicherung angesiedelt wurde. So wurde also zunächst nur für Arbeiter eingeführt, dass sie einen Teil ihres Lohnes (am Anfang waren das 2%) an die Rentenversicherung abführten, ebenfalls zahlten die Arbeitgeber mit gleichem Anteil in die Rentenversicherung ein. Und weil man auch recht sofort Renten und Reha-Leistungen ausschütten musste/wollte, wurde auch von Anfang an vom Staat bezuschusst. Die ersten Renten und insbesondere Reha-Leistungen wurden aus dem staatlichen Zuschuss bezahlt, denn die Rentenversicherung baute zunächst ein Vermögen auf. Dieses sollte etwa für 10(!) Jahre Ausschüttung der Ansprüche der Versicherten reichen. Das dürfte beim damaligen Rentenalter von 70 und der damaligen Lebenserwartung mehr als eine 100%ige Deckung der Ansprüche aus Vermögen gewesen sein. Und: das lag auch nicht einfach so auf Halde. Sondern das wurde von der Deutschen Rentenversicherung investiert. In Wohnungsbau und den Aufbau von Pflege- und Rehabilitationsinfrastruktur. Und zwar mit Gewinn. So dass die Rentenversicherung durchaus vermögend war – zumindest bis zum ersten Weltkrieg. Durch den Krieg gingen die Einnahmen zurück gleichzeitig ging der Rentenversicherung erheblich an Vermögen durch die große Inflation verloren während die Anzahl der Invalidenrenten sprunghaft anstieg. Dafür wurden die Angestellten mit in die Rentenversicherung aufgenommen als Einzahler aber auch als Empfänger natürlich. Der hohe Kapitalstock konnte zwischen den Kriegen nicht wieder hergestellt werden und unter Hitler wurde die Rentenversicherung zudem in ihrer Eigenständigkeit beschnitten und zur Finanzierung des Krieges herangezogen so dass nach dem zweiten Weltkrieg vom Kapitalstock der Rentenversicherung nichts mehr übrig war während gleichzeitig die Zahl der zu Versorgenden hoch war. Und erst hier: Vorhang auf für die Umlagefinanzierung.
Die Umlagefinanzierung der Renten war in den 1950er Jahren dann offiziell geworden und war zu diesem Zeitpunkt auch die genau richtige Lösung, denn es gab keine Rücklage. Zeitgleich wuchs aber die Zahl der Einzahlenden und das Aufkommen der Beiträge stetig an durch die Wirtschaftswunderjahre und Arbeitsmigration und in der Folge durch die Baby-Boomer-Generation. Also eine Situation in der vielen Einzahlende mit wachsenden Löhnen Rentner*innen mit einer (dank Entbehrung in und nach dem Krieg und den allgemeinen Arbeitsbedingungen) eher geringen Lebenserwartung gegenüberstanden. Was lag also näher als auf eine investierte Rücklage zu verzichten und einfach weiterzureichen, was man bekam? Die Umlagefinanzierung ist aber eben nicht per se das Grundgerüst der Deutschen Rentenversicherung gewesen und die Errungenschaft der sozialen Absicherung war zuvor bereits kapitalgedeckt aufgestellt worden. Man kann es auch so betrachten, dass in den 1950er und 1960er Jahren, die Arbeitsrendite sehr hoch war und die Rentenversicherung von dieser hohen Arbeitsrendite mit profitierte.
Nun hat sich bekanntermaßen sowohl die Wirtschaftsstruktur als auch die demographische Struktur weiterentwickelt. Wir stehen nun vor einer Situation in der einerseits die Einzahlergenerationen stetig kleiner werden während die Rentenempfänger*innen einfach nicht mehr 2-5 Jahre nach Verrentung versterben sondern jahrzehntelang Rente bekommen. Auch zahlen im Mittel halt viel weniger Menschen ab 14 in die Rentenversicherung ein als in den 1950er Jahren. Eine ganze Zeit lang konnten wir über Steigerung der Frauenerwerbstätigkeit hier gegensteuern. Dafür haben wir mit der Wiedervereinigung einen Haufen Rentner hinzubekommen, die wir natürlich auch nicht einfach ohne Rente da stehen ließen. Zudem sind aber ein Stück weit heute Arbeitseinsatz und Ertrag deutlich entkoppelter als in den 1950er Jahren. Keinesfalls in jeder Branche. Aber gerade diejenigen Branchen die großen Beitrag zur Wirtschaftsaktivität haben, konnten ihre Arbeitsintensität kontinuierlich reduzieren. Und mussten das übrigens auch, weil schon länger klar ist, dass Fachkräfte knapp werden oder sind. Für die Breite ist zudem wichtiger geworden, dass wir nennenswerte Rendite aus Wissen und Innovation abschöpfen. Die natürlich über höhere mittlere Einkommen der Rentenversicherung schon auch helfen, aber über die Deckelung der Sozialversicherung bei hohen Einkommen eben auch nicht vollständig.
Es wackelt also nun ganz strukturell in der Rentenversicherung. Nicht erst seit gestern sondern schon seit längerem und im Grunde seit der Wiedervereinigung. Das wussten auch die letzten 3-4 Regierungen schon und haben eher Flickwerk betrieben. Anhebung des Renteneintrittsalters – hilft ein Stück, aber kompensiert höchstens zum Teil die höhere Lebenserwartung, nicht jedoch die schrumpfende Einzahlergeneration. Da gibt es dann verschiedene weitere Lochstopfmöglichkeiten:
Frauenerwerbstätigkeit erhöhen. Da treten wir – insbesondere bei dem Anteil der Vollzeit arbeitenden Frauen – ein wenig auf der Stelle. Außerdem ist fraglich, ob man da nicht langfristig dann gleichzeitig an die Wochenarbeitszeit aller Arbeitnehmer*innen ran muss. Auf jeden Fall aber an Betreuungsmöglichkeiten und oft vorliegende weniger sichtbare Hürden für Frauen im Berufsalltag. Das ist einer der Ansatzpunkte, den die Grünen im Programm stark vertreten, der aber vermutlich nicht reichen wird – auch weil daraus ja auch höhere zukünftige Versorgungsansprüche erwachsen, die dann aus der weiter schrumpfenden Nachfolgegeneration wieder zu decken wären.
Migrationsmöglichkeiten erhöhen. Das war natürlich unter den vergangenen 16 Jahren CDU-geführten Regierungen ein NoGo. Die Grünen und die FDP habe das beide im Repertoire. Allerdings muss man natürlich da dann auch genau passende Bewerber*innen akquirieren und die wiederum werden auch von anderen Staaten mit dem selben Problem umworben, die aber strukturell und kulturell schon weiter sind als wir. Alternativ könnte man natürlich jungen Geflüchteten großzügig Zugang zu Bildung ermöglichen und sie unkompliziert und schnell einbürgern. Aber auch da ist vom Status Quo zur Idealsituation noch ein langer Weg – den auch Teile der FDP und SPD nur unterschiedlich weit mitzugehen bereit wären. Das ist ein Teil der Lösung und wird daher ja auch von Grünen wie FDP programmatisch aufgegriffen. Die SPD war hier – wie die Gewerkschaften – lang zögerlich. Und da ja die dann zugewanderten Arbeitnehmer*innen auch wiederum Rentenansprüche erwerben, bin ich keinesfalls sicher, dass man dauerhaft im ausreichenden Maße Zuwanderung generieren könnte ohne dass dies zu größeren gesellschaftlichen Verwerfungen führen würde.
Man könnte die Beitragszahlendenbasis auch durch Eingliederung von Beamten und Selbständigen in die Rentenversicherung erhöhen. Allerdings würde man auch damit das demographische Problem nicht lösen, die Zahl der Beamten ist stetig zurückgegangen und das Durchschnittsalter der noch tätigen Beamten ist hoch. Ob hier dauerhaft viel gewonnen werden kann ist fraglich, zumal die Lebenserwartung von Beamten eher hoch ist. Außerdem würde die Zahlung von Rentenbeiträgen für alle Beamten die öffentlichen Kassen sehr viel kosten – unwahrscheinlich dass das derzeit denkbar ist. Die Einbindung der Selbständigen würde ein Stück weit einen Beitrag leisten, würde aber so manchen Selbständigen auch vor finanzielle Herausforderungen stellen vermutlich. Außerdem würde man dadurch unter Umständen die Einzahlungen von Selbständigen in private Rentenversicherungen reduzieren und damit eine quasi „natürliche“ Ergänzung durch kapitalgedeckte Rentenprodukte schwächen. Dennoch scheint sich eine Einbindung der Selbständigen in irgendeiner Form aus den Parteiprogrammen der Ampelkoalition abzuzeichnen. Die Grünen haben das über die Idee der Bürgerversicherung mit drin, aber auch die FDP möchte hier zumindest eine Pflicht, sich irgendwie rentenzuversichern und die Möglichkeit, dass das über die staatliche Rentenversicherung geschehen kann.
Steuerfinanzierung/Erhöhung des staatlichen Zuschusses: Das wäre das skandinavische Modell. Indem man die Rente direkt über die Steuer und nicht über die Rentenbeiträge deckt (oder zumindest stärker über die Steuer) beteiligt man in stärkerem Maße alle Einkommensformen an der Rentenfinanzierung und trägt damit bei Verschiebung der Einkommensquellen ein Stück weit zum Abbau des strukturellen Probleme bei. Das ist ein durchaus gangbarer Weg. Allerdings scheint mir das eine hohe kulturelle Hürde zu sein, es würde bedeuten, dass wir deutlich das Steueraufkommen erhöhen müssten. Das würde einerseits bedeuten, dass auch die Belastung für Arbeitnehmer*innen steigen würde, direkt über Einkommenssteuern aber z.B. auch über Konsum/Mehrwertsteuer o.ä. Zudem erfordert es auch, guten Zugriff auf das Kapital als Besteuerungsbasis zu haben, wenn man nicht wieder einseitig die schwindenden Arbeitnehmer*innen belasten möchte. Das gestaltet sich, wie wir am langen und noch nicht ausgestandenen Ringen um die Mindeststeuer im Rahmen der G20 sehen, einigermaßen schwierig. Man könnte das natürlich auch über Vermögenssteuern versuchen, das wäre sicher die links präferierte Lösung. Allerdings scheint das ja keine politische und auch Wählermehrheit in Deutschland zu haben und ist daher keine realistische Lösung. Es ist außerdem fraglich ob über eine Vermögenssteuer dauerhaft das Aufkommen generiert werden könnte, das zur Stützung der Rentenkassen nötig wäre.
Eine Erhöhung des staatlichen Zuschusses scheint ohnehin wahrscheinlich, schon um die gegenwärtige Rente sichern zu können, was zumindest bis 2025 bereits gesetzlich fest steht, viel mehr Spielräume für die Zukunft bestehen hier aber nicht, zumindest nicht ohne massive Steuererhöhungen.
Man kann sich natürlich noch alle möglichen sozialistischeren Lösung ausdenken. Verstaatlichung des Kapitals. Hohe Mindestlöhne. You name it. Aber all das wären realpolitisch keine gangbaren Wege, so dass ich mir hier spare, diese einzuordnen.
Es bleibt daher – letztlich in Kombination mit höherer Frauenerwerbstätigkeit, Einbeziehung der Selbständigen und mehr Zuwanderung, was wir auch einfach brauchen um weiterhin produktiv zu sein – die kapitalgedeckte Rente. Am Ende ist die Einführung von Riester- und Rürup-Rente eine erste Entwicklung in diese Richtung, wenn auch freiwillig und privat organisiert, so geht es auch hier darum zusätzlich zur Umlagerente eine Kapitaldecke aufzubauen, die dann die Lücken der gesetzlichen Rente schließt, die durch Erhöhung des Rentenalters und Nullrunden bei der Rente ja schon heute und auch schon vor 10 Jahren spürbar waren und nur absehbar immer größer werden. Nun ist gerade die Riesterrente einfach konzeptionell fragwürdig, war in der Umsetzung vor allem eine Subvention für sonst nicht wettbewerbsfähige Anlageprodukte und reicht einfach nicht. Auch gibt es eben durchaus nennenswerte Einkommensschichten, die auch die sehr geringen Riester-Ansparsätze einfach nicht ansparen können und aber dennoch natürlich auch eine auskömmliche Rente haben sollten. Was jetzt im Raum steht ist natürlich nicht, in Kürze auf eine volle Kapitaldeckung für 10 Jahre Rentenaufkommen zurückzukommen, wie zu Bismarcks Zeiten. Sondern einen Teil der Rentenbeiträge anzusparen und anzulegen. Wir reden hier ja gerade keinesfalls von einer vollen Kapitaldeckung. Die Vorteile liegen m.E. auf der Hand. Durch die Investition des Vermögens der Rentenversicherung profitiert die Rentenrücklage auch von Kapitalerträgen und Innovationsrendite, damit ist die Schrumpfung der Einzahlenden ein Stück weit entkoppelt vom finanziellen Spielraum der Rentenkasse, unterstellt dass wir weiterhin schaffen genug Arbeitnehmende zu haben um produktiv zu sein (und außerdem weiterhin moderates Wachstum und moderate Inflation unterstellen).
Nun ist die Kritik, die ich jetzt schon vielfach gelesen habe, dass durch die Kapitaldeckung der Rente, die Solidarität unter Arbeitnehmer*innen aufgeweicht wird und die Interessenlage des Kapitals damit quasi künstlich auch zur Interessenlage der zukünftigen Rentner*innen wird. Also eine strategisch-politische Schwächung der Arbeitnehmer*innen durch die Hintertür. Ich vollziehe das Grundargument nach, es stört mich aber. Einerseits weil es ohnehin mit der Solidarität unter weiten Teilen der Arbeitnehmer*innenschaft nicht mehr besonders weit her ist. Sehr große Teile derer, die genau von der mangelnden sozialen Absicherung betroffen sind oder sein werden, grenzen sich dennoch innerlich stark vom Arbeiterklassenbild ab, verstehen sich als Mittelschicht und haben keine Interesse an Arbeitskampf oder daran als Arbeiter*innen verstanden zu sein. Andererseits ist halt ohnehin fraglich ob wir weiter in dieser Dichotomie denken sollten. Wir benötigen heute sehr viel mehr als Arbeit und Kapital um zukunftsfähig produktiv zu sein. Ressourcen, Energieautonomie, Innovation und Technologie. Menschen reden nicht umsonst und gar nicht mal so unernst über eine Robotersteuer weil die Beiträge zu Produktion und Wertschöpfung letztlich ganz neu gedacht werden neu gedacht werden müssen. Ich halte das Arbeit-gegen-Kapital-Argument daher für stark verkürzt und den Wertschöpfungsrealitäten nicht angemessen. Natürlich wäre es aus solidargesellschaftlicher Sicht schön wenn man einen direkten Beitrag der Kapitalrendite in die Rente erreichen könnte. Aber das ist gegeben die hohe Mobilität von Kapital und die gegenwärtigen hohen Investitionsanforderungen an Unternehmen einfach nicht realistisch und vor allem gegeben das Wahlergebnis auch offenbar nicht politisch durchsetzbar. Umgekehrt sehe ich einen Kapitalfonds der Rentenversicherung nicht als den Untergang der Arbeitnehmer*innenrechte.
Es gibt eine Reihe valide Einwände gegen kapitalgedeckte Rente. Diese betreffen zum Einen die Frage, wie man einen Kapitalfonds aufbaut. Denn der Aufbau eines Kapitalfonds neben dem weiteren Unterhalt der Umlagerente für die gegenwärtige Rentnergeneration erfordert eine temporär erhöhte Sparquote. Nun haben wir in Deutschland eh schon eine latent hohe Sparquote und geringe Konsumneigung, da wäre eine weitere Erhöhung evtl. schon kritisch für die derzeit angeschlagene Binnenkonjunktur. Hier sehe ich vor allem eine Frage von Zeithorizont und Ausmaß. Natürlich wird man nicht in kurzer Zeit zu einem Kapitalfonds für 10 Jahre Rentenzahlungen kommen, allein schon weil die Rente auch gemessen am heutigen Lebensstandard signifikant höher ist, ebenso wie die Lebenserwartung. Man wird eher über einen längeren Zeithorizont einen Rentenfonds aufbauen, der dann in einigen Jahrzehnten in der Lage sein wird, die Lücken in der Umlage zu schließen. Die Parteien der möglichen Ampelkoalition schwanken hier, ob der Aufbau eines Rentenfonds freiwillig oder als Teil der Pflichtversicherung geschehen soll. Auch ist nicht ganz klar ob hierfür vielleicht doch Beitragserhöhungen möglich wären. Man könnte, so nur meine Ideen, um eine beitragsneutrale Kapitalbildung zu stützen z.B. das Verbot der Rücklagenbildung für die Rentenkasse aufheben und Überschüsse investieren. Oder ohnehin zu tätigende notwendige staatliche Investitionen über den Rentenfonds tätigen und diesem dann die zukünftige Rendite bereitstellen – z.B. in den Bereichen Wohnungsbau und Energieinfrastruktur.
Der andere wesentliche Schwachpunkt einer kapitalgedeckten Rente ist genau der, den wir historisch schon beobachten konnten: Was geschieht, wenn durch eine Krise im Anlagenmarkt das Kapital des Fonds wesentlich schrumpft. Dafür müsste nicht gleich ein Krieg und ein faschistischer Diktator daherkommen, eine Finanzkrise würde, je nach Anlagestrategie des Fonds, schon reichen. Auch hier scheint es mir eine Frage von Größenordnung und Ausgestaltung. Der schwedische Staatsfonds, der schon länger zur Stützung der Rente aufgesetzt wurde, hat über die Zeit seiner Existenz eine durchaus ansehnliche Rendite erwirtschaftet, auch über diverse Krisen der letzten Jahre hinweg. Andererseits lässt die eher suboptimale Performance der Landesbanken in der Finanzkrise nicht unbedingt Vertrauen in die Anlagekompetenz öffentlich-gesteuerter Institutionen in Deutschland wachsen. Man müsste das halt schon schlau und krisensicher managen … das ist der Punkt wo ich ehrlich gesagt die größten Zweifel habe.
Am Ende stellt eine kapitalgedeckte Komponente eine von mehreren notwendigen Komponenten dar, die wir alle brauchen, wenn wir in 30 Jahren noch lebenssichernde Rentenniveaus ausschütten wollen. Idealerweise sollte das aus meiner Sicht kombiniert mit Krisen- und Klimafestigkeit gedacht werden und entsprechend aufgesetzt. Verschiedene der oben genannten Lösungsansätze plus eine kapitalgedeckte Säule können vielleicht Hand in Hand unsere Rentenversicherung von 1957 ins 21. Jahrhundert bringen. Ich würde lieber über eine sozial- und klimagerechte Ausgestaltung diskutieren und sehen dass die Koalition sich an diesem Punkt auch nichts schenkt, sondern versucht hier eine nachhaltige und tragfähige Lösung zu finden, die die Ansätze der einzelnen Koalitionspartner kombiniert (ein sowohl-als-auch und kein entweder-oder), als ganz generell eine Kapitalrente als Neoliberales Teufelszeug abzutun. Das strukturelle Problem der Rente ist nicht kleinzureden und ist viel zu lang verschwiegen worden. Die Reform muss jetzt angegangen werden und zwar mit den politischen und wirtschaftlichen Realitäten, die wir haben. Wenn überraschend in vier Jahren 3/5 der Deutschen links der Mitte wählt, können wir ja nochmal über Vermögenssteuer und Anhebung des Spitzensteuersatzes für die Rente reden 😉
Quellen und Weiterlesen:
- https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Rentenversicherung
- https://www.deutsche-rentenversicherung.de/DRV/DE/Ueber-uns-und-Presse/Historie/historie_detailseite.html
- https://www.t-online.de/finanzen/news/unternehmen-verbraucher/id_90976428/spd-fdp-und-gruene-so-will-die-kuenftige-ampelkoalition-die-rente-sichern.html
- https://www.handelsblatt.com/finanzen/vorsorge/altersvorsorge-sparen/die-rente-als-wahlkampfthema-diese-plaene-haben-die-parteien-fuer-die-altersvorsorge-und-das-bedeuten-sie-fuer-die-sparer/27621802.html?ticket=ST-2617659-QusmYrlKrMLFe0agI3is-cas01.example.org
- https://www.fr.de/politik/rente-deutschland-beitraege-ampel-koalition-spd-gruene-fdp-verdi-chef-finanzen-alter-news-91058334.html
- https://de.wikipedia.org/wiki/Kapitaldeckungsverfahren